Heft 263 – 02/2025
Neuorientierung der Klimapolitik –
die Land- und Waldwirtschaft rücken ins Zentrum
#meinung #debatte #spw
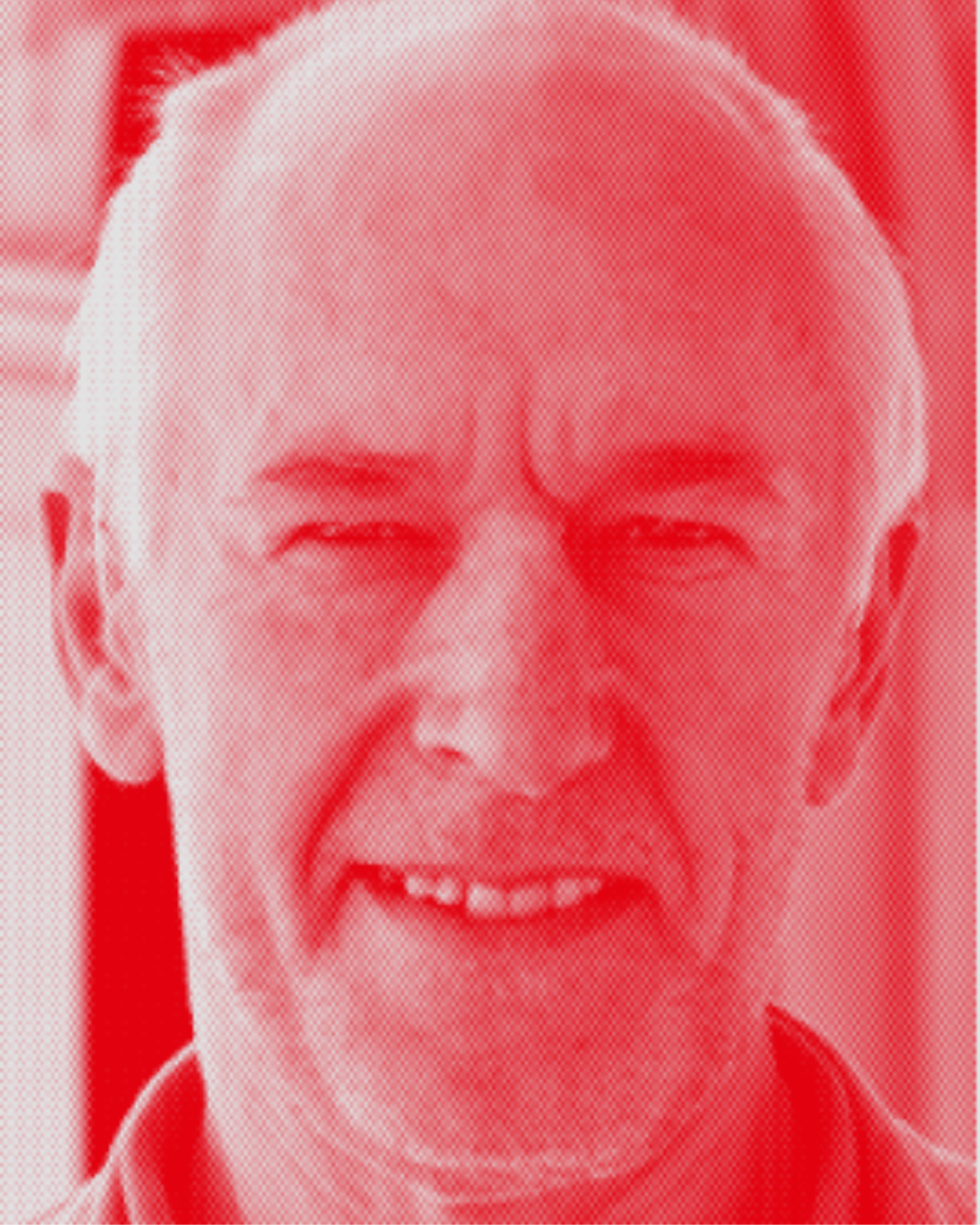
Foto: © privat
Karl-Martin Hentschel, Mathematiker, Autor – u.a. des Handbuch Klimaschutz (Wie Deutschland das 1,5-Grad-Ziel einhalten kann: Basiswissen, Daten, Maßnahmen – Oekom Verlag München). Mitglied im Vorstand des Netzwerk Steuergerechtigkeit und bei Scientists for Future.
von Karl-Martin Hentschel
Dänemark hat beschlossen, 10 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche zu bewalden.¹ Diese Nachricht wirft den Scheinwerfer auf die große Lücke der bisherigen Klimapolitik in Deutschland, die wir nicht mehr ignorieren dürfen! Die neue Waldstrategie der Bundesregierung² will zwar den bestehenden Wald an die Erwärmung anpassen. Die große Bedeutung der Neuwaldbildung wird aber immer noch völlig ignoriert. Der folgende Artikel basiert auf einer intensiven Diskussion bei Scientists for Future und rückt die zentrale Rolle der Waldwirtschaft in den Fokus der Klimapolitik.
Wir sind in Deutschland an einem Wendepunkt der Klimapolitik. Bisher lag der Fokus in Deutschland und weltweit an erster Stelle bei der Energiewende – vor allem beim Kohleausstieg. Das ist zwar kurzfristig immer noch der wichtigste Punkt, betrifft aber entscheidend nur noch 5 Länder (China, Indien, Indonesien, USA und Polen)³. Insgesamt kann man sagen: Die Energiewende im Stromsektor läuft – zum Glück: 2023 erfolgten weltweit bereits 80 Prozent aller Kraftwerk-Investitionen in Erneuerbare – weil sie mittlerweile billiger sind. In Deutschland haben wir zumindest das Kapitel Kohle, die 2018 noch 85 Prozent der Emissionen im Stromsektor verursachte, 2030 fast abgeschlossen.⁴ Aber die Ablösung von Erdgas durch Wasserstoff steht noch bevor.
Für die Industriewende sind durch die EU mit dem CO2-Preis wichtige Weichen gestellt worden. Entscheidend sind drei Sektoren (Zement, Stahl und Grundstoffchemie), die über 90 Prozent der Emissionen verursachen. Dort investiert niemand mehr in CO2-emittierende Techniken, da sie nicht mehr abzuschreiben sind. Und der Umbau beginnt gerade – wenn auch holprig.⁵
Die Verkehrswende ist noch sehr kritisch. Zentral ist die Elektrifizierung der PKWs und LKWs, die 80 Prozent der Verkehrsemissionen ausmachen.⁶ Hierfür hat Brüssel die Weichen gestellt – aber nur, wenn das Verbrenner-Aus-Datum 2035 hält! Die notwendige Verkehrsverlagerung muss aber erst noch gestartet werden.
Bei der Hauswärme sind die notwendigen Gesetze nun doch verabschiedet – auch das zunächst so umstrittene GEG samt WPG⁷. Nun sind alle Kommunen verpflichtet zur Klimawende und sind mehr oder weniger fleißig dabei, ihre Wärmepläne zu machen.⁸ Ich vermute, dass daran auch die neue Koalition nur noch wenig ändern wird, da sonst das Klimaschutzgesetz nicht eingehalten werden kann.
Das sind alles noch gigantische Herausforderungen – aber die wichtigsten Weichen sind gestellt. Alle Sektoren unterliegen nun den CO2-Preisen – bis auf die offen klaffende Lücke: Landwirtschaft und Bodennutzung⁹. Heute verursachen diese beiden Bereiche schon 16 Prozent der Emissionen, wovon man die Kompensationsleistung der Wälder abziehen kann¹⁰. Die lag bisher bei 6 Prozent, ist aber zuletzt deutlich eingebrochen¹¹. Je mehr nun die Emissionen der anderen Sektoren zurückgehen, desto größer wird der Anteil von Landwirtschaft und Bodennutzung. Denn dafür gibt es noch keine CO2-Preise¹². Und im Sommer 2024 sind Klimaschutzmaßnahmen in der Landwirtschaft durch die Agrarministerkonferenz der EU erst einmal ausgesetzt worden. Wenn es so weiter geht, werden im Jahre 2045 zwei Drittel – möglicherweise sogar 80 Prozent der Restemissionen aus der Landwirtschaft und der Bodennutzung stammen! Der Rest stammt aus anderen nichtvermeidbaren Emissionen – vor allem der Zementindustrie und dem Flugverkehr. Die müssen dann zusätzlich kompensiert werden.
Damit rücken Landwirtschaft und Bodennutzung ins Zentrum der Klimapolitik. Dazu muss man wissen, dass auf 50 Prozent der Fläche Deutschlands Landwirtschaft betrieben und auf 30 Prozent Wälder stehen. Die Agrarflächen werden zu 56 Prozent für die Tierernährung genutzt (davon die Hälfte Dauergrünland), nur 27 Prozent für Nahrungspflanzen, 12 Prozent für Energiepflanzen und 2 Prozent für Industrierohstoffe.¹³
Was ist also zu tun? Wie können die Emissionen von Landwirtschaft und Bodennutzung vermieden oder ausgeglichen werden? Dazu vier Punkte:
- Erstens müssen die Emissionen der Landwirtschaft ernsthaft reduziert werden. Strategisch entscheidend ist dafür neben der Reduzierung der Nitratdünger und der Gülleausbringung vor allem die Reduzierung des Fleisch- und Milchkonsums. Dies erfordert aber eine wesentliche Änderung im Ernährungsverhalten, würde aber erfreulicherweise einhergehen mit einer erheblichen Reduzierung der benötigten Flächen.
- Zweitens kann der Anbau von Energiepflanzen (vor allem Raps für Treibstoffe und Mais für hoch subventionierten Biogasanlagen¹⁴) komplett eingestellt werden. Er hat sich leider als ineffizienter Irrweg der Energiewende erwiesen. Die bestehenden Biogasanlagen können aber künftig trotzdem eine wichtige Rolle spielen, wenn sie mit Gülle und anderen Reststoffen im Rahmen der Klimaschutzkonzepte der Gemeinden weiterbetrieben werden. Sie sollten künftig als Spitzenkraftwerke nur dann laufen, wenn Sonne und Wind wenig produzieren und die Strompreise hoch sind. Sie würden dann nur 1000 statt 4000 Stunden im Jahr laufen, dafür aber mit einer viel höheren Leistung. Dazu benötigen sie auch größere Gasspeicher.
- Drittens müssen die Emissionen der Bodennutzung drastisch reduziert werden. Sie stammen überwiegend aus ehemaligen trockengelegten Mooren und Feuchtgebieten. Diese müssen weitgehend wieder vernässt werden – was aber auf große Schwierigkeiten stößt. Hier können auch sogenannte Paludi-Kulturen (Nasskulturen) künftig eine wichtige Rolle spielen.
- Viertens aber – und das ist strategisch der wichtigste Punkt – sollten neue Wälder aufgeforstet werden. Auch Agroforst und Bruchwälder in wiedervernässten Flussniederungen können einen wichtigen Beitrag leisten.¹⁵
Und wieviel würde das bewirken? Wälder können in den ersten 100 Jahren, bis sie ausgewachsen sind, CO2 im großem Ausmaß aus der Atmosphäre holen. Mit einer Neubewaldung von 10 Prozent der Agrarfläche (nicht jedoch auf Grünland!¹⁶ ) könnte zum Beispiel die Speicherleistung der Wälder in Deutschland in den kommenden Jahrzehnten um etwa 25 Prozent gesteigert werden, so dass mehr als die berechneten Restemissionen CO2 von den Wäldern aufgenommen werden¹⁷. Nach 100 Jahren sinkt natürlich die Aufnahme von Kohlenstoff wieder, da das Holzvolumen nicht mehr zunimmt. Durch eine Umstellung des Häuserbaus auf Holzträger anstelle von Stahl und Beton würden unsere Gebäude zu zusätzlichen Kohlenstoffspeichern für Jahrzehnte, wenn nicht für Jahrhunderte¹⁸. Auf diese Weise vermeiden wir CO2-Emissionen durch Zementeinsatz beim Bau und wir gewinnen Zeit, um die Restemissionen auf null zu bringen. Darüber hinaus können wir dadurch sogar CO2 aus der Atmosphäre zurückholen.
Natürlich sind die Wiedervernässung der Moorböden und die Aufforstung neuer Wälder eine enorme Herausforderung – aber es ist machbar. Eine Alternative zur Neuwaldbildung bzw. eine Ergänzung ist natürlich CCS¹⁹ – das Verpressen von CO2 in geeigneten Tiefengesteinen, damit es mineralisiert oder BECCS²⁰– das Verbringen von Kohlenstoff aus Biorohstoffen in die Erde. Dazu gehört auch die Produktion und Einsatz von Pflanzenkohle²¹. CCS mag sinnvoll und bezahlbar sein, wenn das bei der Zementherstellung chemisch freiwerdende CO2 direkt im Produktionsprozess abgeschieden wird, aber für die Kompensation der Emissionen der Landwirtschaft wäre es extrem teuer. Denn dann müsste das CO2 erst durch DAC²² aus der Luft wieder zurückgewonnen werden. Dagegen soll BECCS nach den Plänen des Weltklimarats künftig eine wichtige Rolle spielen. Aber auch das ist sehr teuer und benötigt ebenfalls Agrarflächen und die Entwicklung geeigneter Verfahren.
Die naheliegende Option – sozusagen das „Gebot der Stunde“ ist daher jetzt die Neuwaldbildung und die Moorbildung. Heute kostet der Aufkauf der Agrarflächen und die Aufforstung nur ein Viertel der Kosten für CCS²³. Die Flächen wären vorhanden²⁴. Denn durch die Reduzierung der Viehzucht und die komplette Einstellung des Anbaus von Energiepflanzen werden über 20 Prozent der Agrarflächen verfügbar – selbst wenn wir komplett auf ökologische Landwirtschaft umstellen und dafür deutlich mehr Flächen für die Nahrungspflanzenproduktion benötigen. Wir könnten daher Förderprogramme starten, durch die in den kommenden zwanzig Jahren 10 bis 20 Prozent der Agrarfläche schrittweise aufgekauft wird. Oder die Bauern werden durch eine entsprechende Förderung selbst zum Aufforsten gewonnen und damit selbst zu Forstwirten.²⁵
Die Kosten bewegen sich im zweistelligen Milliardenbereich. Auf 20 Jahre verteilt sind sie gering im Vergleich zu den Kosten der Hauswärmeumstellung. Am besten sollten sie im Rahmen der EU-Agrarprogramme aufgebracht werden. Aber auch nationale oder Länderlösungen sind denkbar. Alle Verantwortlichen sind aufgefordert, dieses riesige Vorhaben in Angriff zu nehmen. Denn ohne das ist die Klimaneutralität in Deutschland bis 2045 kaum erreichbar.
¹ Siehe: https://wildbeimwild.com/daenemark-will-1-milliarde-baeume-pflanzen-und-10-der-landwirtschaftlichen-nutzflaeche-in-wald-umwandeln/?utm_source=brevo&utm_campaign=Newsletter%20November%202024_copy_copy&utm_medium=email
² Siehe https://www.bmel.de/DE/themen/wald/waldstrategie.html
³ Relevanten Neubau von Kohlekraftwerken gibt es noch in China, Indien und Indonesien. Ein hoher Anteil im Bestand gibt es noch in USA und Polen – siehe: https://www.globalenergymonitor.org/de/projects/global-coal-plant-tracker/tracker/rele
⁴ Nachdem auch NRW für 2030 das Kohle-Aus beschlossen hat, bleibt nur noch der Nachzügler Brandenburg.
⁵ Die Ankündigungen von Entlassungen bei Mittal und bei Thyssen-Krupp zeigen, dass hier noch nachgebessert werden muss. Der Grenzausgleich CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) ist für 2026 von der EU beschlossen worden, regelt aber noch nicht den Verkauf von Stahl ins Nicht-EU-Ausland.
⁶ Verkehr verursacht 2023 22% der Treibhausgabe (gemessen in CO2-Äquivalenten), davon 3% Flugverkehr, 1% Schiff, 18% Straßenverkehr, Bahn ist vernachlässigbar, weil schon weitgehend elektrifiziert.
⁷ Es handelt sich um ein verbundenes Gesetzespaket: GEG – Gebäudeenergiegesetz, WPG – Wärmeplanungsgesetz
⁸ Bis 2026 müssen die Städte über 100.000 Einwohner, bis 2028 alle anderen ihre Pläne vorlegen.
⁹ Ich benutze aus Gründen der Verständlichkeit „Bodennutzung“ synonym für den LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry)
¹⁰ Emissionen der Landwirtschaft 2023: ca. 60T toCO2äq; der Bodennutzung: ca. 48T toCO2äq; Kompensation durch Wald: ca. 44T toCO2äq. Der Anteil wächst, je mehr die anderen Sektoren reduzieren. Siehe zur Bodennutzung: https://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/treibhausgas-emissionen-in-deutschland/emissionen-der-landnutzung-aenderung#veranderung-des-waldbestands-; siehe Treibhausgasentwicklung insgesamt: https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/treibhausgas-emissionen
¹¹ Zuletzt war der Wald durch die Verluste sogar zur CO2-Quelle geworden. Siehe https://www.geo.de/natur/oekologie/der-deutsche-wald-gibt-jetzt-mehr-kohlenstoff-ab–als-er-aufnehmen-kann-35126934.html
¹² Dänemark hat als erstes Land weltweit beschlossen, dass die CO2-Preise auch für die Landwirtschaft gelten.
¹³ UBA – siehe https://www.umweltbundesamt.de/umweltatlas/umwelt-landwirtschaft/einfuehrung/landwirtschaft-in-deutschland/wie-wird-die-landwirtschaftliche-flaeche-in. Die Grafik von Christian Viktor weicht leicht davon ab.
¹⁴ Die Förderung von Biogasanlagen war leider ein Fehler. Der Preis von 20 Cent pro kWh liegt heute beim Vierfachen von Photovoltaik. Nur die extrem hohen Subventionen halten sie noch am Laufen.
¹⁵ Ein erster Anreiz für Aufforstung wurde mit dem Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz des BMUV geschaffen.
¹⁶ Ich betrachte daher nur die Ackerflächen, da Grünland schon heute eine CO2-Senke ist.
¹⁷ 10% der Agrarfläche entsprechen einer Steigerung der Waldfläche um 17%. Der heutige Wald hat ca. 2200 Mio. to C gespeichert, das entspricht ca. 8000 Mio. to CO2. 17% entsprechen ca. 1400 Mio. to CO2. Die geschätzten nicht vermeidbaren Restemissionen im Jahre 2045 aus der Landwirtschaft betragen 30 Mio. to CO2. Siehe https://www.umweltbundesamt.de/bild/flaechennutzung-in-deutschland und https://www.wald.de/waldwissen/wie-viel-kohlendioxid-co2-speichert-der-wald-bzw-ein-baum/
¹⁸ Siehe https://www.pik-potsdam.de/en/news/latest-news/buildings-can-become-a-global-co2-sink-if-made-out-of-wood-instead-of-cement-and-steel. Es gibt auch neue Forschungsergebnisse mit Carbonfasern.
¹⁹ CCS – Carbon Capture and Storage – Verpressen von CO2 in großen Tiefen, in denen es mineralisiert, oder in alten Gaskavernen.
²⁰ BECCS – BioEnergieCCS – Speicherung von Kohlenstoff aus weiterverarbeiteten Biorohstoffen in der Erde
²¹ Siehe: https://biochar-zero.com/de/stadtgruen/pflanzenkohle-fuer-stadtbaeume/
²² DAC – Direct Air Capture – direkte Rückgewinnung von Kohlendioxid aus der Luft
²³ Siehe https://handbuch-klimaschutz.de/assets/pdf/Handbuch-Klimaschutz_NRW.pdf
²⁴ Allerdings importiert Deutschland erhebliche Mengen and Nahrungs- und Futtermittel. Wir werden auch künftig nicht autark sein.
²⁵ Das Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz des BMUV ist immerhin ein erster Schritt.
